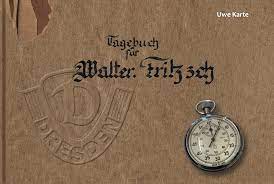
Tagebuch für Walter Fritzsch: Eine deutsche Biografie 1920 – 2020
Das Buch „Tagebuch für Walter Fritzsch“ ist vordergründig kein Fußballbuch, sondern vielmehr ein Buch über ein Leben im 20. Jahrhundert. Und die Einsichten, die dabei zutage kommen, sind für eine umfassende Beurteilung jener Zeit von unschätzbarem Wert. Walter Fritzsch ist als akribischer Chronist kein Intellektueller, so übermitteln seine Niederschriften eine unmittelbare Sichtweise auf die Zeit. Diese ist eine ganz persönliche und widerspricht nicht selten dem objektiven historischen Blick, der in späterer Zeit auf die Vergangenheit geworfen wurde. Das disqualifiziert die Historie nicht, aber relativiert sie, – mindestens dahingehend, daß die Menschen, die in dieser Vergangenheit lebten, einen anderen Blick auf die Geschehnisse hatten, als die späteren Generationen. Vielen ehemaligen DDR-Bürgern geht es ja beispielsweise auch so, daß sie die heutige Geschichtsauffassung von der DDR nicht mit ihren persönlichen Wahrnehmungen von damals in Übereinstimmung bringen können. Will man annäherungsweise eine wirklichkeitsgerechte Geschichtsauffassung erlangen, darf man diesen Widerspruch nicht aufzulösen versuchen, sondern muß ihn aushalten, denn nur so wird es möglich sein, zu verstehen, warum sich Menschen in früherer Zeit so und nicht anders verhalten haben. So kann zum Beispiel durch die Auszüge aus den Tagebüchern herausgelesen werden, warum junge Menschen, die im zweiten Weltkrieg an die Ostfront kamen, der Propaganda von der höheren Rasse erlagen, weil sie sichtbar einen gravierenden kulturellen Unterschied in der Lebensweise der beiden Völker feststellten. Oder daß die Nachkriegszeit nicht allein deswegen die Zeit der Verdrängung des faschistischen Erbes war, weil erst im Nachhinein das ganze Ausmaß der Schrecknisse der Naziideologie deutlich wurde, sondern weil die Menschen viele Jahre nach dem Krieg durch die Lebensmittelknappheit unmittelbar um ihr Überleben kämpfen mußten. Wer existentiell mit dem Hunger ringen muß, der hat keine Zeit und schon gar nicht die Freiheit, die Vergangenheit kritisch zu analysieren.
Das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen Einsichten, die sich durch das Lesen dieses Buches ergeben könnten. Dabei versteht es Uwe Karte bei der Darlegung in wunderbarer Weise, sehr prägnant, informativ und zudem unterhaltsam die Tagebuchnotizen mit den Hinweisen auf darin nicht aufgeführte Umstände zu begleiten, so daß ein viel umfänglicheres Bild entsteht, als es das bloße Aufzeichnen der Tagebücher ergeben würde.
Der Autor hat mit diesem Buch eine immense Leistung vollbracht, die die größte Hochachtung und Aufmerksamkeit verdient.
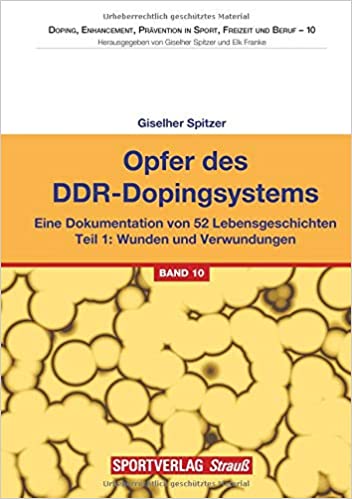
Opfer des DDR-Dopingsystems Teil 1 und 2
Die beiden Teile der Dokumentation von 52 Lebensgeschichten sind schockierend und können einen sprachlos machen. Es geht um das Zwangsdoping an minderjährigen Jugendlichen, das zudem noch ohne ihr und ihrer Eltern Wissen durchgeführt wurde. Mit anderen Worten, es geht in den Büchern um tausendfach und systematisch ausgeübte Menschenversuche, und den daraus resultierenden Schäden, die sich für die Sportler in der Zukunft und darüber hinaus noch an ihren Kindern ergeben haben, sofern sie nicht schon an Kinderlosigkeit litten oder Fehl- und Totgeburten ertragen mussten.
Der Staat DDR, der gar nicht laut genug propagieren konnte, dass er die menschlichere Alternative gegenüber dem „Westen“ ist, stellte sich mit diesen menschenverachtenden Praktiken selbst ins Abseits. Letztlich war es in Bezug auf den Sport ein dreifacher Betrug: zum ersten an den Sportveranstaltungen, deren Ergebnisse in den siebziger und achtziger Jahren wert- und bedeutungslos geworden sind, sofern Sportler aus der DDR erfolgreich waren, zweitens an den Sportlern selbst, die nie erfahren werden, zu welchen sportlichen Leistungen sie ohne Doping fähig gewesen wären, und drittens an den Zuschauern, die mit solchen unkorrekten Mitteln zum Besten gehalten wurden.
Allein schon bei dieser Thematik zeigt sich, welche Berechtigung es hatte, dass die Menschen, die in diesem Gesellschaftssystem lebten, dieses 1989 schließlich abschafften, – wenn das auch aus anderen Gründen geschah, da sie von dem flächendeckenden Dopingmissbrauch nichts wussten und im Rausch der sportlichen Erfolge auch gar nichts ahnten.
Indes, dies sei in aller Deutlichkeit ebenso gesagt, das vereinigte Deutschland hat sich keineswegs besser verhalten, wenn aus der Studie herauszulesen ist, dass viele Funktionäre, Ärzte und Trainer trotz nachgewiesenen Verbrechens an minderjährigen Menschen weiter in ihren angestammten Positionen für den Garant sportlicher Erfolge tätig sein konnten. Und das Rechtssystem in Deutschland hat sich darüber hinaus sittlich selbst disqualifiziert, wenn die lächerlichen Strafen für die Hauptzuständigen der Dopingvergabe, die übrigens von den möglichen Schäden wussten und diese ignorierten, im Verhältnis zu ihren menschenunwürdigen Verantwortungslosigkeiten gesehen werden. Und ihre Reaktionen auf die Verurteilungen zeigen ja auch, dass sie sich durch das Strafmaß ihres menschenverachtenden Tuns gar nicht bewusst werden, was aber eigentlich das gesellschaftstragende Ziel der Rechtsprechung sein sollte.
Giselher Spitzers Arbeiten sind auch in der Hinsicht wertvoll, dass sie in unmissverständlicher Art klar machen, dass es sich bei den Sportlern um Missbrauchsopfer handelt, egal ob sie dadurch dauerhaft geschädigt wurden oder nicht, ob sie darüber sprechen können oder das Thema vielleicht aus Scham verdrängen.
Und letztlich erheben diese Gespräche auch ethische Fragen des modernen Sports im Allgemeinen. Ist es gerechtfertigt, Leistungen anzutrainieren, ob aus politischem oder finanziellem Anreiz, die das Maß des körperlich Erträglichen bei weitem übersteigen und oft gesundheitliche und seelische Folgeschäden nach sich ziehen. Diese Frage müssen sowohl Sportler, Trainer als auch Zuschauer beantworten, wollen sie die Sportaktivitäten, wie sie heute noch ausgeführt werden, weiterhin rechtfertigen.

Man kann Reiner Stach nur danken für diese bewunderungswürdige Arbeit. Er hat ein Meisterstück von einer Biographie geschaffen.
Ist man vorher bei der Ansicht von drei Bänden und mehr als 2000 Seiten vielleicht abgeschreckt, weil man es in dieser Dimension kaum für wahrscheinlich hält, vom Stoff dauerhaft gefesselt zu werden, selbst wenn die Werke von Franz Kafka großes Interesse geweckt haben, so beweist der Biograph in diesem Fall das genaue Gegenteil.
Das liegt daran, daß sich Reiner Stach in seiner Darstellung nicht nur direkt auf das persönliche Dasein Kafkas konzentriert, sondern dieses in einen umfassenden Zusammenhang stellt mit den damals vorherrschenden gesellschaftlichen, künstlerischen und geistigen Verhältnissen. Und die Zeit von 1883 bis 1924, also die, in der Franz Kafka lebte, ist mit ihren vielen Veränderungen, mögen das die Entwicklungen der Industrie sein, oder die Herausbildung neuer Erkenntniszweige wie der der Psychoanalyse, aus heutiger Sicht sehr interessant, weil wir mittlerweile mit dem Umbruchprozess zum digitalisierten Zeitalter einen ähnlichen alle Lebensvorgänge einschließenden Wandel erleben. Selbst Bewegungen, die heute als alternatives Denken allgegenwärtig sind, wie die Lebensreform, die unter anderem auch den Vegetarismus als andersartige Essgewohnheit vorschlägt, und der sich auch Kafka unterzog, haben in dieser Epoche ihre Wurzeln.
All das stellt der Autor in einer sehr zugänglichen Art und Weise dar und erhellt, indem er diesen Rahmen mit Kafkas Existenz verknüpft, die düstere Atmosphäre, die bisher sein Werk, wie auch sein Leben vermittelte. So lernen wir Kafka auf völlig neue Weise kennen, nämlich als einen hochsensiblen Seismographen, der deswegen mit seinen Romanen und Erzählungen so hellsichtig das zukünftige Leben seiner und der folgenden Generationen beschreiben konnte.
Darüber hinaus vermag Reiner Stach auch selbst höchst beachtenswerte Verbindungen der damaligen Entwicklungen zur gegenwärtigen Zeit herzustellen, wie, um nur ein Beispiel zu nennen, die Entstehung der Cafés, welche damals Institutionen wurden, „die verlässliche und dennoch zu nichts verpflichtende Geselligkeit ermöglichte.“ (Band 1, S. 363-364) Treffender könnte man die Sehnsucht einer Geborgenheitsart vieler Gegenwartsmenschen in der modernen Zivilisation nicht darlegen. Auf diese Weise sind die Bände in vielfältigster Weise eine geistige Anregung und zudem angenehm unterhaltsam geschrieben, – eine Symbiose, die äußerst selten anzutreffen ist.

Wenn man sich vorstellt, wie viele türkische Menschen in Deutschland leben und vor allem wie viele Jahrzehnte schon, dann kann es den Deutschen erstaunen, wenn er sich in Bücher aus der Türkei vertieft, wie wenig ihm von der Vielfältigkeit der türkischen Kultur bekannt ist. Es könnte auch anders formuliert werden, nämlich wie der ausschließliche Brennpunkt auf das Schreckliche, das in den letzten Jahren in diesem Land geschehen ist, – zumindest aus der Perspektive eines demokratischen Lebens – gerade die Mannigfaltigkeit des Lebens auch dieses Landes ausblendet. Bei einem Buch, das im Gefängnis geschrieben wurde, könnte man glauben, daß es einen solchen Fokus noch unterstützt.
Das Überraschende an diesem Buch jedoch ist, daß es das gerade nicht tut. Die Rechtlosigkeit der Andersdenkenden, die darin geschildert wird, ist so eingebunden in die Darstellung der Normalitäten des Alltagslebens, daß zumindest eine Ahnung entsteht, wie Völker Diktaturen akzeptieren können. Es ist letztlich wohl auch eine Überlebensstrategie. Und über derartige Überlebensstrategien berichtet Ahmet Altan in reichhaltiger und beeindruckender Weise, damit er seine Haft, die eigentlich keinen Grund hat, ertragen kann.
Darüber hinaus berichtet er noch über den Ablauf seiner Aburteilung. Diese Vorkommnisse, bei denen die bloße Denunziation schon zu einer Inhaftierung und allein die Auslegungen von Äußerungen zu einer gerichtlichen Verurteilung ausreichen, erinnern an die schlimmsten stalinistischen Zeiten, die es Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts auch in einem Teil von Deutschland gegeben hat. Doch es ist die weltgeschichtliche Ironie einer jeden Diktatur, die nie von Dauer ist, selbst wenn sie als ewig existierende ausgerufen wird, daß sie in ihren Handlungen, Andersdenkende mundtot zu machen und damit aus dem Gedächtnis des Volkes auszulöschen, gerade mit ihrem Unrecht dafür sorgen, daß diese für lange Zeit in Erinnerung bleiben. Denn deren Einkerkerung ist Mahnung für die nachfolgenden Generationen, daß jegliche Art der Willkürherrschaft das wesentlichste Grundbedürfnis des Menschen verletzt, die Freiheit seines geistigen Eigentums, – also das Einzige, was uns erst zu Menschen werden läßt.
Und ein Humanist, wie es Ahmet Altan ist, hat es in jedem Fall verdient, mit seinen Gedanken im zukünftigen Gedächtnis bewahrt zu bleiben.
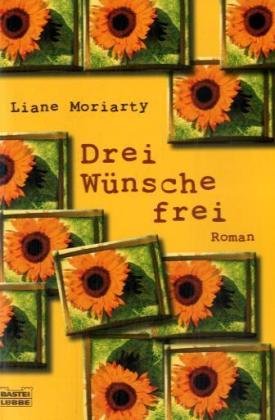
Es geschieht nur ganz selten, daß es gelingt, in dem unübersichtlichen Dschungel von Buchveröffentlichungen einen Gegenwartsroman zu finden, der das wirkliche Leben zu spiegeln vermag und darüber hinaus auch noch unterhaltsam ist. Liane Moriarty gelingt das mit ihrem Buch „Drei Wünsche frei“ auf wunderbare Weise. Sie hat das seltene Talent prägnant zu erzählen und dabei den Ton der heutigen Zeit zu treffen. Zudem verzichtet sie, was heute so gut wie gar nicht mehr anzutreffen ist, auf jede Eitelkeit in Stil und Sprache. Letzteres ist sicherlich auch ein Verdienst der Übersetzerin Sylvia Strasser. Sie sei hier ausdrücklich erwähnt, weil Übersetzer immer im Schatten der Autoren stehen, obwohl sie für das Gelingen eines fremdsprachigen Buches einen nahezu gleichwertigen Beitrag leisten müssen.
Es geht in dem Roman um drei Schwestern mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen, aber mit einer Kernfrage, wie finde ich den meinem Leben entsprechenden Platz. Es wird ein ganzes Spektrum von dramatischen und kuriosen Situationen präsentiert, in denen sich die Schwestern weiterentwickeln, so daß sie im Nachhinein immer wieder verblüfft feststellen könnten, daß sie eine solche persönliche Entwicklung gar nicht erwartet hätten. In diesem Sinne könnte das Buch auch so gelesen werden, als handelte es sich bei den drei Schwestern um eine Person mit ihrer Möglichkeit der unterschiedlichsten Lebenswege.
Wer ein Buch sucht, das geistig anregt und zugleich kurzweilig ist, der sollte diese Geschichte lesen.
Es ist ein Debütroman mit fast keinem Makel. Die einzige kleine Einschränkung: er ist fünfzig Seiten zu lang. Mit der Auflösung der Geschehnisse zum Geburtstagsessen hätte die Geschichte enden sollen, um den Leser zu ermuntern, den Lebensfaden der virtuellen Personen selber weiterzuspinnen…

Wenn jemand einmal etwas ganz eigenständiges und persönliches lesen und hören möchte, der greife zum Buch und zur CD „Träume ändern ihr Gesicht“ von Kerstin Rodger. Das Faszinierende daran ist, daß die vielen Lebensweisheiten, die darin zu finden sind, fast beiläufig präsentiert werden, so daß die Texte trotz der philosophischen Tiefe bzw. Weite nahezu unbeschwert wirken. So erfährt man, daß der Umgang mit Behinderung frei von Sentimentalität ist und schlichtweg gelernt werden muß, daß menschliche Liebe erst mit der Kommunikation entsteht, zum Beispiel durch das Lachen eines Kindes, Zeit nicht alle Wunden heilt oder Homöopathie Hilfe für chronische Krankheiten bietet, wenn die Schulmedizin den Patienten bereits aufgegeben hat.
Dazu besitzt das Buch sehr ansprechende Fotos, mit einem kleinen Makel, es ist kein Porträt von Kerstin Rodgers dabei. Einem solch grundehrlichen Menschen hätte man gern direkt ins Gesicht geschaut, – hier stand sich die Kunst wohl selbst im Weg.
